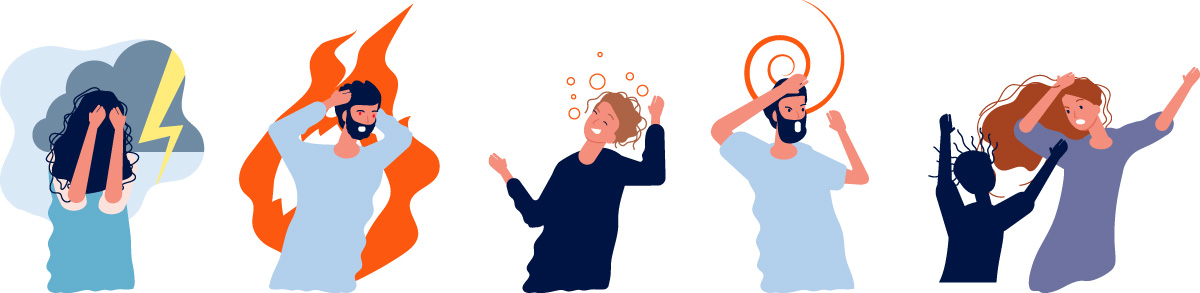Zu den Abhängigkeitserkrankungen gehören
Alkoholabhängigkeit, Abhängigkeit von illegalen Drogen, Medikamentenabhängigkeit, Pathologisches Glücksspielen und Medienabhängigkeit.
Die Psychotherapie schließt sich, je nach Schweregrad der Abhängigkeit, in der Regel an eine Entwöhnungsbehandlung an, die ärztlich begleitet wird.
Ich unterstütze Sie dann, wenn Ihr Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist, wenn Alkohol, Drogen, Medikamente, das Glücksspiel oder der exzessive Konsum digitaler Medien wie ein Ausweg erscheinen, aber deutlich wird, dass diese Verhaltensweisen keine Lösungen sind, sondern ins Abseits führen.
Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn die Betroffenen wenig Kontrolle über das Ausmaß ihres Konsums haben und ein starkes Verlangen spüren die Substanz (Alkohol, Drogen, Medikamente) zu konsumieren. Ein häufiges Merkmal der Abhängigkeit ist die Toleranzentwicklung (die Dosis wird gesteigert, um weiterhin die gleiche Wirkung zu erzielen). Wenn die Betroffenen nicht konsumieren, können sie körperliche und psychische Entzugssymptome erleben.
- Agoraphobie
Betroffene haben Angst, eine vermeintlich gefährliche Situation nicht rechtzeitig verlassen zu können, wenn starke Angstsymptome oder Panikattacken auftreten und/oder sich dabei peinlich zu verhalten (z.B. ohnmächtig werden auf einem öffentlichen Platz). Sie erleben starke Angst, wenn sie sich in großen Menschenmengen befinden (z.B. in Kaufhäusern, Kinos, Konzerten), öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder sich weit von zu Hause entfernen (z.B. verreisen). Die jeweiligen Situationen werden häufig vermieden.
- Generalisierte Angststörung
Die Betroffenen leiden unter andauernden Sorgen vor zukünftigem Unglück oder einer Erkrankung, die einen selbst oder Angehörige treffen kann. Weitere Sorgenbereiche sind: Familiäre/soziale Beziehungen, Arbeit und Leistung, Gesundheitssorge, Finanzen. Häufig wird erfolglos versucht, die belastenden Gedanken zu unterdrücken. Zudem treten körperliche Belastungssymptome auf, z.B. Zittern, Schwindel, Übelkeit, innere Unruhe, Unfähigkeit sich zu entspannen, Konzentrations- und Schlafstörungen.
- Panikstörung
Wie aus scheinbar heiterem Himmel kommt es zu plötzlichen, unvorhersehbaren Anfällen intensiver Angst (Panikattacken), die von körperlichen und psychischen Symptomen begleitet werden. Zu den körperlichen Symptomen zählen zum Beispiel Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühle, Brustschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Kribbelgefühle oder ein Gefühl der Unwirklichkeit. Aufgrund der starken körperlichen Beschwerden suchen viele Betroffene zunächst medizinische Hilfe. Zu den psychischen Symptomen zählt häufig die Angst, den Verstand oder die Kontrolle zu verlieren. Die körperlichen und psychischen Symptome werden ängstlich beobachtet und wahrgenommen, wodurch es zu einem Aufschaukelungsprozess mit Zunahme der Panik (Teufelskreis der Angst) kommt. Die erste Panikattacke tritt oft in Folge belastender Lebensumstände auf: Verlust einer nahestehenden Person, Verlust einer wichtigen Beziehung oder des Arbeitsplatzes.
- Soziale Phobie
Im Mittelpunkt steht hier die Befürchtung, sich in einer sozialen Situation peinlich zu verhalten (z.B. zu schwitzen, zu zittern, nichts mehr sagen zu können) oder negativ bewertet zu werden. Die Betroffenen erleben starke Angst bis hin zu Panikattacken. Dabei kann sich die Angst auf spezielle Situationen beziehen wie zum Beispiel Referate halten, Essen in der Öffentlichkeit oder aber auch in fast allen sozialen Situationen auftreten. Die Betroffenen versuchen, diese Situationen zu vermeiden oder sie stehen sie nur unter hoher Anspannung durch. In schweren Fällen kann das Vermeiden sozialer Ereignisse zur kompletten sozialen Isolation führen.
- Spezifische Phobie
Die spezifische Phobie beschreibt Ängste, die sich auf eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Objekt beziehen. Kontakt mit dem angstauslösenden Reiz oder nur der Gedanke daran löst bei den Betroffenen immer eine Angstreaktion aus. Die Reize werden in der Regel vermieden oder die Situationen werden nur unter hoher Anspannung ausgehalten. Beispiele sind Höhenangst, Spinnenphobie, Blut- und Spritzenphobie, Zahnarztphobie oder Emetophobie (die Angst sich zu erbrechen).
Die Betroffenen fühlen sich durchgehend psychisch belastet, in Folge einer andauernden Überforderung. Meistens werden keine Pausen und Erholungsphasen bei beruflichen und privaten Verpflichtungen eingelegt. Der hohen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft folgen dann in der Regel ein Leistungseinbruch und ausgeprägte Erschöpfungszustände. Zusätzlich entwickeln viele Betroffene ebenfalls eine depressive Symptomatik, die ohne die vorherige Phase der Überforderung wahrscheinlich nicht entstanden wäre.
Depressionen gehen mit einer Vielzahl verschiedener Symptome einher, so leiden Betroffene häufig unter einer dauerhaft gedrückten oder gereizten Stimmung. Neben Niedergeschlagenheit und Traurigkeit sind häufige Beschwerden Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und Appetit- oder Gewichtsverlust (oder Zunahme). Die Gedanken sind häufig pessimistisch und es treten Selbstvorwürfe oder Selbstanklagen auf. Aktivitäten, die früher Freude bereiteten, erscheinen anstrengend und freudlos. Oft findet sich eine so genannte kognitive Triade, die eine negative Sicht auf sich selbst, auf die Umwelt und auf die Zukunft beinhaltet (Beck, 1999).
- Anorexie
Betroffene haben eine selbst herbeigeführte Gewichtsabnahme und ein deutliches Untergewicht durch (eine sehr) eingeschränkte Ernährung. Nahrungsmittel, die als „dick machend“ angesehen werden, werden weggelassen. Manchmal wird einer Gewichtszunahme auch durch Fasten, Erbrechen, Gebrauch von Abführmitteln oder durch exzessive Bewegung entgegengewirkt. Die Betroffenen haben häufig eine verzerrte Körperwahrnehmung und haben Angst zuzunehmen.
- Bulimie
Betroffenen nehmen große Mengen Nahrung auf (Essanfälle) und erbrechen sie anschließend wieder. Manchmal werden auch Abführmittel eingenommen oder exzessiver Sport getrieben, um das Gewicht zu regulieren. Die Betroffenen haben das Gefühl, die Menge nicht kontrollieren zu können. Sie haben massive Angst vor Gewichtszunahme und können das körperliche Völlegefühl nicht aushalten. Das Gewicht befindet sich oft im Normalbereich.
Betroffene haben eine besondere Form der Wahrnehmung, des Denkens und des Fühlens, so dass es insbesondere in der Beziehung zu anderen Menschen zu ausgeprägten Konflikten und Schwierigkeiten kommt. Persönlichkeitsstörungen sind somit als interaktionelle Störungen zu verstehen. Es kann häufig zu starken Gefühlsschwankungen kommen, wodurch ein durchschnittlicher Alltag konfliktreich und oft als nicht bewältigbar erlebt wird. Das Leid der Betroffenen erwächst aus der Beeinträchtigung der Wahrnehmung, der Impulskontrolle, des emotionalen Erlebens oder der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Typisch für Persönlichkeitsstörungen ist ein früher Beginn der Symptomatik und einer Lebensgeschichte, die das Erleben von Geborgenheit und Sicherheit unmöglich machte und zur Ausbildung tief verwurzelter, destruktiver und anhaltender Annahmen über die eigene Person und die Umwelt führte. Diese Erfahrungen erschweren es dem Betroffenen, das eigene Verhalten an eine aktuelle Situation anzupassen.
Beispiele sind die emotional-instabile (Borderline), histrionische, zwanghafte, ängstliche, abhängige oder narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Kennzeichnend für eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist das Erleben eines Ereignisses, was traumatisierend war, bspw. aufgrund der Schwere der Erfahrung (tiefgreifende Bedrohung des eigenen Lebens oder des Lebens anderer) oder der subjektiv wahrgenommenen Hilflosigkeit. Doch nicht nur Überlebende schwerwiegender Naturkatastrophen, Unfälle oder Gewalt entwickeln eine PTBS, oft kann auch ein unerwarteter Verlust einer wichtigen Bezugsperson traumatische Reaktionen auslösen. Betroffene erleben nach dem Ereignis emotionale Taubheit, Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit.
Traumatische Reaktionen beinhalten häufig ein sich aufdrängendes, ungewolltes Wiederleben von Szenen des belastenden Ereignisses (Intrusionen, Flashbacks) sowie eine Vielzahl körperlicher und psychischer Symptome wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schreckhaftigkeit oder erhöhte Wachsamkeit. Vielfach liegen dissoziative Symptome vor, durch die PTBS-Betroffene sich „wie in Watte gepackt“ fühlen oder „sich nur von außen beobachtend“ wahrnehmen und diese und andere Derealisations- und Depersonalisationsphänomene als äußert unangenehm und einschränkend erleben. Menschen mit PTBS verlieren häufig das Vertrauen in ihre Umwelt, fühlen sich zunehmend unsicher und vermeiden alles, was sie an das traumatische Ereignis erinnert.
Betroffene leiden unter Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen. Häufig treten beide zusammen auf.
- Zwangsgedanken
sind wiederkehrende Gedanken, Impulse oder Vorstellungen, die die Betroffenen als aufdringlich und unangemessen empfinden (z.B. „Ich habe den Herd nicht aus gemacht“). Häufig lösen die Gedanken Angst und Unbehagen aus. Der Versuch, die Gedanken zu unterdrücken oder zu vermeiden, führt in der Regel zu einem verstärkten Auftreten. - Zwangshandlungen
werden immer wieder in einer bestimmten Weise ausgeführt (z.B. Kontrollieren, Hände waschen, Zählen). Dabei fällt es den Betroffenen schwer, Widerstand gegen die Handlungen zu leisten. Typisch sind Hygiene-, Wiederholungs- und Kontroll-, Zähl- und Symmetriezwänge.